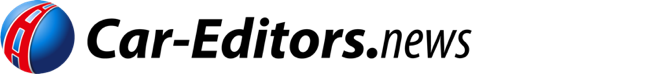Wie deutsche Autowerke den Wettbewerb mit China aufnehmen
„Das ist der beste Produktionsanlauf der Unternehmensgeschichte“, sagt Michael Bauer, Leiter Produktion in Europa und Südafrika bei Mercedes-Benz. Nie zuvor sei eine Fertigung so schnell wieder angelaufen als im Werk Rastatt nach dem Umbau. Mercedes bereitet die Fabrik auf die den neuen CLA vor, das erste Kompaktmodell auf der neuen MMA-Plattform. Im nächsten Jahr kommen die Coupé-Limousine und die Kombiversion Shooting Bake auf den Markt – und werden auf immer mehr preiswerte Autos aus China treffen.
Mercedes steht wie die gesamte deutsche Automobilindustrie vor der größten Herausforderung seit Jahrzehnten: Wie lassen sich am Standort Deutschland trotz hoher Arbeits- und Energiekosten weiter profitabel Autos bauen? Das war eines der Themen beim diesjährigen Kongress der Fachzeitschrift „Automobil Produktion“, an dem auch Manager von Audi, Ford, Skoda und Seat teilnahmen. Der Schlüssel dazu: Digitalisierung.
„Bis 2025 werden wir die Effizienz allein mit Digitalisierung um 20 Prozent steigern“, versprach Mercedes-Manager Bauer. Das wäre ein Quantensprung. Üblich ist es, die Produktivität um drei bis fünf Prozent im Jahr zu steigern. Deshalb soll Rastatt auch zur Blaupause für alle Mercedes-Werke weltweit werden, auch in China.
Unter anderem soll der Einsatz von Künstlicher Intelligenz Kosten reduzieren und die Arbeit vereinfachen. Beispiel Lackierung: „Äußere Einflüsse wie das Wetter beeinflussen die Qualität. Wir müssen heizen, kühlen oder die Luft befeuchten. Das lässt sich über KI besser steuern.“ So will Mercedes in der Lackieranlage 20 Prozent Energie einsparen und dabei die Qualität des Farbauftrags verbessern. Die Lackierung ist der größte Energiefresser in der Produktion.
Gerd Walker, Vorstand Produktion und Logistik bei Audi, geht einen ähnlichen Weg, steckt seine Ziele ebenfalls hoch: In weniger als zehn Jahren will der Hersteller seine Fabrikkosten halbieren und die Fahrzeuge doppelt so schnell produzieren wie derzeit, so Walker. „Der Schlüssel dazu ist die Komplexität zu reduzieren und auf Digitalisierung zu setzen.“ Jeden Tag verbaut das Werk Ingolstadt 17 Millionen Teile in den Fahrzeugen. 1500 Schrauben sind es in jedem Audi Q6.
Künftige Modelle sollen modular produziert werden. Das heißt, größere Teile werden in einem Stück gefertigt, womit die Zahl der „Schraubfälle“ um ein Viertel sinken soll. Auch sei es möglich, „falls wir uns trauen“, statt einer lackierten Karosserie durchgefärbte Kunststoff zu montieren: „Wir montieren das Auto nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen.“
Das Audi-Motorenwerk im ungarischen Györ, größtes seiner Art im Konzern, wird derzeit auf Elektromotoren umgestellt. Auch dadurch sinkt die Komplexität. Ein Verbrennungsmotor kann aus mehr als 1000 Teilen bestehen, ein Elektromotor aus kaum 20. Die hoch motorisierten Quattro-Modelle wie der Q6 haben drei davon an Bord. Es ist damit zu rechnen, dass nicht nur Audi künftig weniger Mitarbeiter braucht. Walker: „Hier kommt uns aber der demographische Wandel entgegen. Es wird ohnehin zunehmend schwerer, genügend Mitarbeiter zur finden.“
Den wohl größten Umbau eines deutschen Autowerkes hat Ford in Köln hinter sich. Wo bis vor einem Jahr der Fiesta vom Band lief, wird seit zwei Wochen der elektrische Explorer gebaut. Die Produktion von bis zu 350.000 Verbrennungsmotoren pro Jahr wurde ebenfalls eingestellt. Für Rene Wolf, Leiter der Produktion von Ford Europa, war das kein leichter Schritt, war doch die Fiesta-Fertigung in Köln eines der effektivsten Autowerke der Welt. Aber, so Wolf: „Die Fabrik der Zukunft ist lean and green.“
Schlank und grün ist unter anderem das Komponentenwerk, wo die Elektromotoren gebaut werden. Verschiedene Werksteile wurden dazu zusammengefasst, um Stellen in der Leitung und Wartung zusammenzulegen. Wir früher Motoren, Getriebe und Druckgussteile hergestellt wurden, laufen nun Elektromotoren vom Band.
Das über 100 Jahre alte Ford-Werk wurde komplett umgebaut. Ziel ist eine 95-prozentige Auslastung. Denn nur so lässt sich der Wettbewerb mit den elektrischen Importmodellen aus China bestehen. Auch wenn der völlige Umstieg auf die E-Mobilität in Deutschland länger dauern wird als erwartet. Mercedes will bis Ende des Jahrzehnts 50 Prozent batterieelektrische Autos bauen, so Michael Bauer. „Aber wir werden bis in die 2030er Jahre Verbrenner in der Produktion haben. Das bedeutet mehr Komplexität in der Produktion.“
Während sich Ford in Köln auf das Elektroauto konzentrieren kann, laufen in Rastatt weiter beide Antriebskonzepte vom Band, BEV und Verbrenner. Das gilt auch für das BMW-Werk in Leipzig: Werksleiterin Petra Peterhänsel ist stolz darauf, alle Antriebe auf einer Linie bauen zu können. „So können wir auf Veränderungen im Kundenverhalten reagieren.“
Derzeit verhalten sich die Kunden in Deutschland eher abwartend und kaufen wieder mehr Verbrenner. Elektroautos aus Leipzig gehen verstärkt in den Export, so der Mini Countryman, das größte Modell, das dort gebaut wird. 600 neue Stellen wurden für die Produktion des SUV von Mini geschaffen.
Auch bei BMW kommt verstärkt Künstliche Intelligenz zum Einsatz, um die Effizienz zu erhöhen. So inspizieren Kameras die lackierten Oberflächen auf mögliche Schäden. Und vom „Zählpunkt acht“, dem Ende der Produktion, fahren die Autos selbständig zur Verladung. Autonome Mobilität macht’s möglich.
Technologie ist für Andreas Dick, Vorstand Produktion von Skoda, der Schlüssel, um die Herausforderung aus China zu bestehen. Er hat mehrere Jahre in China gearbeitet, bevor er Vorstand der tschechischen VW-Tochter wurde. Sein Fazit: „Wir sind gut im klassischen Automobilau. Aber wir müssen bei Elektrik und Elektronik gegenüber China aufholen.“
Doch während junge Chinesen heute schon weitgehend digital leben, alles per Handy erledigen und kein Problem damit haben, auch per Gesichtserkennung zu bezahlen, gibt es in Deutschland nach wie vor Berührungsängste mit der digitalen Welt. Ein Grund: Im chinesischen VW-Werk Anhui liegt das Durchschnittsalter der Belegschaft bei 29, in den Skoda-Werken in Europa bei 43 Jahren. Dennoch ist Dick sicher, dass Europa die Herausforderung bestehen kann: „Wir müssen verschlanken und Bürokratie abbauen.“ So werde die Fertigung schneller und effizienter. (aum/Guido Reinking)
Mehr zum Thema: China , Autoproduktion , deutsche Werke
Teile diesen Artikel: